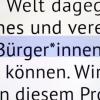Es ist einfach, naheliegend und billig, sich in der Genderdebatte kopfschüttelnd zu mokieren. Ist doch alles ein weltfremder, verkniffener Irrsinn! Minderheitenprogramm! Dritte Toilette, diverses Pinkeln, unaussprechliche Sternchen, die wie Urschreie den Klang unserer Sprache verhunzen … Ja geht’s noch, ihr Herren Professorinnen und werten Sprecher*innen, ihr verkrampften Volkserzieher und Bevormunder! Haben wir keine anderen Probleme als diesen Gender-Pipifax …
Doch dieses ätzende Unverständnis, mit dem die Mehrheit der „Leute“ auf den Tadel an AKKs Genderwitz reagiert, ist womöglich auch nur eine Abwehrreaktion auf den ungeschickten, gelegentlich jakobinischen Furor, mit dem die Debatte (auf-)geführt wird. Debatte? Es ist eher ein Aufheulen und Abwiegeln, ein Bezichtigen und Aneinandervorbeireden, ein fiktiver Lagerkampf. Jüngstes Beispiel: der „Aufruf zum Widerstand“ des Vereins Deutsche Sprache gegen „zerstörerische Eingriffe in die deutsche Sprache“, wie sie im Genderstern gipfelten. 100 Erstunterzeichner, unter ihnen Schriftstellerinnen und Schriftsteller von Rang und Namen, rügen den „Gender-Unfug“. Dürfen die. Und „Unfug“ ist ein geradezu altersmild tadelndes Wort, auf der Empörungsskala ziemlich weit unten angesiedelt. Keine Übergriffigkeit.
Die Debatte um "sexistische Sprache" ist alt
Nun gibt es aber auch Wortmenschen und Autor*innen, die das ganz anders sehen und dem Verein widersprechen wie der Sprachwissenschaftler Thomas Niehr, der das Gendern der Sprache für ein legitimes Anliegen hält und davor warnt, dem Bedürfnis, in der Sprache explizit mitgenannt zu werden, gleich etwas Diktatorisches anzudichten.
Es könnte also diskutiert werden – zur Sprache haben schließlich alle etwas zu sagen, weil jeder damit klarkommen will und muss. Wir wissen das spätestens seit den Scharmützeln um die Rechtschreibreform. Seither schreibt Deutschland übrigens divers.
Das Sternchen aber wirft ja nur ein neues Schlaglicht auf eine ziemlich betagte Debatte, die tief zurück im 20. Jahrhundert wurzelt. Schon in den 1970er Jahren wurde „sexistische Sprache“ identifiziert und gegeißelt. Schöner ist der Sprachgebrauch seither nicht geworden – aber geschlechterfairer, sensibler und reflektierter ganz sicher. Die Asymmetrie zwischen Mann und Frau ist nicht verschwunden, hat aber unbestritten weniger Schlagseite – insbesondere in Behördenansprachen und Unternehmenskulturen.
Die Fragen nach Geschlechteridentitäten sind wichtig für eine Gesellschaft
Drei Geschlechter in einer Stellenanzeige, eine neue österreichische Nationalhymne – genügt das? Soll es nur noch Neutralisierungen geben? Leute, Menschen, Personen, Teams? Wie also weiter? Darüber streiten, lohnte. Doch was passiert? Die Liste der Erstunterzeichner des „Unfug“-Aufrufs wird öffentlich durchgefieselt. Sind da nicht AfD-nahe Leute dabei? Und ist nicht die „Pegidahaftigkeit“ des Vereins Deutsche Sprache längst festgestellt? Wir reden also nicht mehr über die Sache, sondern sortieren wortmächtig und moralsatt die Welt in böse Cowboys und gute Indianer.
Geschlechteridentitäten und Machtverhältnisse sind wichtige gesellschaftliche Fragen – sie werden nicht auf dem Klo und auch nicht im Wörterbuch gelöst. Es schadet dem Anliegen von Gender-Gerechtigkeit, wenn die Debatte auf solche Felder abgedrängt ist. Wenn die Sprache auf krude Weise missverstanden wird (etwa in der fatalen Gleichsetzung von grammatikalischem Wortgeschlecht und biologischem Geschlecht), reißt der Gesprächsfaden. Er reißt aber auch, wenn jeder Vorschlag, sprachlich betonierte Ungleichheit aufzubrechen, pauschal als Doppelnamen-Gedöns verhöhnt wird.