Die Empörungswellen rauschen längst regelmäßig von beiden Seiten heran – und dazwischen schüttelt eine Gesellschaft den Kopf. Was ist da bloß los?
Auch wenn die zum Verständnis nötigen und gleich zu klärenden Begriffe zumeist englische sind: Man muss nun wirklich nicht nach England schauen, wo kürzlich etwa Aberhunderte Bücher aus Universitätsbibliotheken entfernt wurden, weil sie zu klischeehafte, Rassismusnahe Darstellungen enthielten, darunter auch das einer ehemaligen Sklavin über ihre Erinnerungen – solche bizarren Fälle beim Versuch, alles gut und richtig zu machen, gibt es längst auch in Deutschland. Und man muss auch nicht in die USA schauen, wo der selbst dunkelhäutige Sprachwissenschaftler John McWorther die Bewegung gegen Rassismus als Auserwähltenideologie kritisiert, als selbstgefälligen Unsinn, der sich als Weisheit ausgibt, als antihumanistische Religion und totalitäre Umprogrammierung – solche heftigen Worte gegen ein doch moralisch scheinendes Ansinnen gibt es längst auch bei uns. Fürs Erste sollen hier Stichworte genügen: „Hotel Drei Mohren“ und Gendersternchen, Dreadlocks und Unisex-Toiletten.
Von der einen Seite sind es sogenannte Aktivistinnen und Aktivisten, die mit Wucht und großer moralischer Geste konkrete Verfehlungen und generelle Missstände in immer mehr Bereichen anprangern. Von der anderen Seite werden sie dafür wütend beschimpft, ätzend verspottet, im Grunde zurückgewiesen wie eine Schar verzogener Kinder, die in ansonsten ja auch schon komplizierten Zeiten gefälligst nicht so frech sein und schätzen lernen sollen, wie gut es ihnen eigentlich geht. Darum geht es. Und wer es ist, der sich da empört und vor allem auch zurückempört, das gehört wesentlich dazu, um letztlich zu verstehen, was hier los ist. Doch das Grundsätzliche erklären die Begriffe.
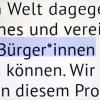
(für Kundige auch gut überspringbar)
- Woke/Wokeness: Wie das Wort hat sich letztlich auch die Bewegung entwickelt. Ursprünglich nämlich galt dieses Wachsein, diese Aufmerksamkeit Anzeichen des Rassismus in den USA vor gut 100 Jahren. Inzwischen aber ist die Bewegung global und der Anwendungsbereich viel größer geworden. Es geht zum Beispiel auch um:
- Gender: Obwohl es das heißt, ist es nicht einfach ins Deutsche mit „Geschlecht“ zu übersetzen. Denn wenn das biologische Geschlecht gemeint ist, heißt es im Englischen „Sex“; Gender dagegen meint das soziale Geschlecht, das in den gesellschaftlich ausgeprägten Rollenbildern oft auch hauptsächlich Mann- und Frau-Muster erkennen lässt, aber eigentlich ein viel größeres Spektrum hätte. Gendergerechte Sprache ist darum (nach dem Aufgeben des im Deutschen grammatikalisch explizit geschlechtsneutralen generischen Maskulinum, der bei Bürger die männlichen wie die weiblichen Bürger meint) im eigentlichen Sinne auch nicht das Hinzufügen der Schauspielerin zum Schauspieler, sondern das Einfügen von dem mit Sternchen oder Doppelpunkt markierten Gottisschlag, der Sprechpause bei Schauspieler:in. Denn nur so eingeschlossen ist:
- non-binär: Es gibt also nicht bloß wie in der exakt zweiwertigen Computersprache 1 oder 0, also hier Mann oder Frau, sondern ein ganzes Spektrum dazwischen mit fließenden Übergängen. Und das gilt nicht nur für die je eigene Geschlechtsbestimmung, sondern auch für die Wahl des Liebespartners. Einzelne Stationen des Spektrums davon listet das gängige Kürzel auf:
- LGBT: Die Buchstaben stehen für die englischen Begriffe für lesbisch, schwul, bisexuell und transgender – Letzteres bedeutet eine uneindeutige Geschlechtszuordnung, mitunter auch einen vollzogenen Wechsel der Bestimmung. Das (aus dem Lateinischen kommende) Trans („jenseits“) steht im Gegensatz zum Cis („diesseits“) eines Menschen, der sich immer dem zugehörig fühlte, als was er bei der Geburt bestimmt wurde. Erweiterbar ist das Kürzel noch mit Q für queer (relativ unspezifisch, hauptsächlich nicht rein heterosexuell) und I für intersexuell (auch biologisch zwischengeschlechtlich) und A (für nicht sexuell und nicht geschlechtlich) und einem offen alles weitere ergänzenden +. Das Symbol dafür:
- Regenbogen: Auch hier hat sich das Spektrum in den vergangenen Jahren noch erweitert. Zum ursprünglich sechsfarbigen horizontalen Exemplar, das lange für die Bekenntnis und Emanzipation nicht rein heterosexuell Liebender stand, ist entsprechend der Gender-Ausdifferenzierung eine vierfarbige, pfeilartige Ergänzung (siehe unser Titelbild) hinzugekommen, das schließlich ausgesparte Weiß ist offen wie das +. Dieses Vielfaltssymbol ist damit auch zu einem woken Zeichen geworden für:
- Diversity: Heißt wörtlich übersetzt Vielfalt oder auch Diversität, das d von divers wiederum ist das, was man heute auch schon als Ergänzung für alles Non-Binäre in Stellenanzeigen zusätzlich zu w(eiblich) und m(ännlich) finden muss, weil eine dritte, unspezifische Geschlechtsmöglichkeit in Deutschland offiziell anerkannt ist. Die Vielfalt der Diversity stammt ursprünglich auch aus dem Zusammenhang des Anti-Rassismus. So soll zum Beispiel Diversität in Gremien oder im Fernsehen für die Sichtbarkeit und die Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund sorgen. Im Gegensatz am leichtesten ausgedrückt durch Nicht-Weiße, denn die direkte Bezeichnung fällt mitunter schwer, einst gebräuchliche Begriffe gelten als nicht mehr als opportun, dafür etwa:
- PoC: Dieses Kürzel steht für das englische People of Colour, wörtlich übersetzt Menschen von Farbe, was aber nicht heißt, dass das einst übliche Farbige dafür verwendet werden könnte. Schwarze werden oft nicht zu den PoC zu zählen, sodass man sagen könnte, es gibt Menschen in weiß, schwarz, und alles andere ist PoC. Aber nicht nur die Vielfalt der Hautfarbe ist von Belang, sondern auch die kulturelle. Denn ein vielfach im Zeichen der Wokeness beanstandetes Vergehen ist die sogenannte:
- Kulturelle Aneignung: („cultural appropriation“) Ein immer häufiger auftauchender Begriff (ähnlich wie „toxic masculinity“, „toxische Männlichkeit“, für die von der privaten Beziehung bis zur Weltpolitik giftigen Charaktereigenschaften, die eben nicht Kooperation und Offenheit, Gesundheit und Harmonie fördern). Es geht dabei um die Übernahme von Symbolen oder Ausdrucksformen aus anderen Kulturen, vor allem beanstandet, wenn diese als bloße Klischees gebraucht werden oder wenn die Übernahmen von dominanten aus kleineren, schwächeren Kulturen getätigt werden, weil darin eine koloniale Geste anklingt. Das war etwa in den USA zu beobachten, als eine weiße Malerin in einem Werk den schwarzen Jungen im Sarg malte, der bei Rassenunruhen ums Leben kam. Aber auch Musikstars werden oft bezichtigt: Rapper Kendrick Lamar, weil seine Tänzer als Kung-Fu-Kämpfer auftraten, Katy Perry, weil sie ihr Haar in speziellen, „Cornrows“ genannten Zöpfen trug, und auch Pop-Königin Beyoncé Knowles, weil sie klassischen indischen Schmuck abseits seines Zusammenhangs als reine Inszenierung trug.

Aber eben: Solche Fälle gibt es längst auch in Deutschland. Der Bayerische Rundfunk strich eine Figur des Kabarettisten Helmut Schleich, weil er sich für seinen Maxwell Strauß (seit vielen Jahren) das Gesicht schwarz färbte („Blackfacing“) und damit nun Empörung auslöste. Fridays for Future lud eine Musikerin wieder aus, weil diese als Weiße das Haar in Filzzöpfen trug – die Dreadlocks aber gerade (nach Gang und Wandel durch die gesamte Menschheitsgeschichte) als Symbol in einer Rassismus-Debatte in den USA stand. So wie neulich auch die Schweizer Band Lauwarm von der Bühne gebuht wurde, weil sie als Weiße Dreadlocks hatten, und auch noch teils afrikanische Kleidung trugen und sie Reggae-Musik spielten.
Man könnte Geschichten dieser Art in großer Zahl aneinanderanderreihen, und dann noch von einigen der sehr vielen Entgleisungen des Genderns erzählen wie kürzlich der, als nicht nur die Diskussionsrunde der Grünen Claudia Stamm mit Jugendlichen zur Farce wurde, sondern auch gleich die Anmoderation der ARD–Moderatorin: „Herzlich willkommen, herzlich willkommen ihr Schülerinnen und Schüler, ihr Schülerinnen, ihre Schüler:innen, ihr Lernende und natürlich auch an die Lehrkräfte, an die Lehrer, an die Lehrer:innen, an die Lehrenden, ich hoffe, es fühlen sich jetzt wirklich alle angesprochen.“ Peinlich, wo doch gerade die Grünen als die Partei der Wokeness gelten und den Öffentlich-Rechtlichen auch von Sprachwissenschaftlern der Vorwurf gemacht wird, gegen die Empfehlung des Deutschen Rechtschreibrates an einer „gesellschaftlichen Umerziehung“ mitzuwirken, Teil einer ideologischen Bewegung zu sein, und nicht zufällig, weil ja auch in der Belegschaft die Mehrheit links-grün wähle.
So findet das Bizarre und Lustige eben doch auch schnell ein Ende – denn in solchen Vorwürfen scheint ein großer Ernst in der Debatte auf und eine Wucht, von der nicht selten behauptet wird, sie habe das Zeug, diese Gesellschaft (weiter) zu spalten. Auch weil die Woken mit ihrem Auftreten den Rechten geradezu in die Karten spielen könnten – denn sie verstören und verärgern mit ihren Haltungen und der Rigorosität ihrer Einsprüche auch viele, die sich einfach in ihrem alltäglichen Leben behelligt und bevormundet fühlen, das als Angriff auf die Normalität empfinden.
Der Vorwurf lautete, dass die Grenzen des Sagbaren verschoben werden
Damit ist das entscheidende Wort gefallen. Und erhellenderweise tritt es im Vergleich zwischen den Woken den tatsächlich Rechten noch deutlicher hervor. Als letztere nämlich vor einigen Jahren mit grellen Kommentaren für Empörung sorgten, lautete der Vorwurf, sie würden die Grenzen des Sagbaren verschieben – und aus Worten würden Taten folgten. Nun wirkt es bei den Woken, als würden sie die Grenzen des Nicht-mehr-Sagbaren stetig ausweiten – und Zweck ihrer Sprachhygiene ist es, dass Wörter den Blick auf die Welt prägen und verändern, und damit die Wirklichkeit. Die Rechten sprachen im Namen einer vermeintlichen Mehrheit gegen Minderheiten – und nun, in den Debatten um die Wokeness, sind es die, die sich dagegen empören, die es im Namen einer Mehrheit tun: Gegen deren Interessen wendeten sich die Aktivisten mit ihrem Minderheitenlobbyismus.
Der Kontrast zwischen rechts und woke und den jeweiligen Reaktionen darauf zeigt zudem: Klassisch war die sogenannte Identitätspolitik das Anliegen, für strukturell benachteiligte Gruppen, wesentlich auch Minderheiten, die Gleichberechtigung in der Gesellschaft zu erwirken; bei den Rechten wurde Identitätspolitik zu einem nationalistischen Anliegen im Namen einer vermeintlichen Mehrheit, die fürchtet unter die Räder zu kommen; bei den Woken nun ist die klassische Identitätspolitik zurück, allerdings in neuer Rigorosität: Denn statt der Gleichstellung mit den strukturell Bevorzugten (Einheimischen, Männern, Weißen …) geht es hier eigentlich um die Abschaffung des Maßstabs. Ganz anders steht also so etwas wie Mehrheit damit in Zweifel. Weil die Wokeness im viel Grundsätzlicheren infrage stellt: Was ist Normalität?

Haben wir nicht andere Probleme? Ist es nicht ein Zeichen von dekadenten Gesellschaften, also solchen, die sich in der Neige ihrer Blüte befinden, dass sie sich ihre letzten Wohlstandsgenerationen nicht um die großen Fragen kümmern, sondern sich in Luxusdetails verlieren und zerstreiten? Wachheit gegenüber Rassismus, Sexismus und Diskriminierung gehören zweifelsohne zu liberalen Demokratien. Aber die überbordenden Ansprüche der Wokeness und die in „Sozialen Netzwerken“ dazu herrschende Unerbittlichkeit leisten doch beidem einen Bärendienst: zum einen werden die moralischen Fragen in ihrer Tragweite und Dringlichkeit ununterscheidbar, wenn schwerer Missbrauch und eine falsche Frisur gleichermaßen für Empörung sorgen, was letztlich zu einer moralischen Ermüdung oder auch zu einer Wut gegenüber allen führen kann, die sich als Opfer gebärden; und zum anderen wäre an der Zeitwende, an der sich Deutschland in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens befindet, doch ein Miteinander auch der Generationen notwendig, in dem sich individuelle Freiheiten und gesellschaftliche Solidarität die Waage halten.
Und ist das, worum es hier geht, den Preis der Verwerfungen wirklich wert? Der erhabene Standpunkt des moralischen Anspruchs wirkt da jedenfalls schnell wie einer, der nur nach eigener Wirkmacht trachtet – passend zu den Dynamiken der multimedialen Aufregungsgesellschaft und ohne Gewähr dafür, dass das Ergebnis wirklich im Sinne der Diskriminierten ist, nicht bloß in dem der Lauten.
Reicht es nicht, dass die Ehe für alle eingeführt wurde?
Im Konkreten, erster Fall: Reicht nicht, dass in den vergangenen Jahren doch zum Beispiel die „Ehe für alle“ eingeführt wurde? Muss nun noch das freie geschlechtliche Selbstbestimmungsrecht für alle ab 14 sein, die die Regierung plant? Bedeutet die Freiheit für die wenigen, die diese wirklich benötigen, hier nicht Behelligungen, ja Verwirrungen für die vielen, die sie nicht brauchen? Wenn man nur mal an die ohnehin schon herausfordernde Zeit der Pubertät denkt, die damit doch vor noch größeren Fragen der Identitätsfindung stellt. Wie bei der Forderung nach nur noch Unisex-Toiletten: Damit sich manche im Entweder-Oder nicht unwohl fühlen, sollen Frauen und Männer in Kauf nehmen, womit sich sehr viele von ihnen nicht wohlfühlen? Bis hin zur Sprache, die ja gegendert umständlicher und hässlicher wird? Was nun ja doch auch eine deutliche Mehrheit stört und sie gegenüber eventuell auch außerhalb der Sprache Diskriminierten unduldsamer werden lässt.
Im Konkreten, zweiter Fall: Mit welchem Recht tritt eine junge Generation an die gesamte Kulturgeschichte und ihre Zeugnisse heran und sortiert diese in gut und schlecht? Tilgt Wörter und Bildnisse, würde am liebsten Denkmäler stürzen und kappt aufgrund eines teils hanebüchen verkürzten Verständnisses Referenzen? Zur Differenzierung der Auseinandersetzung mit Geschichte trägt jedenfalls nicht bei, wenn Bücher mit im historischen Kontext verwendeten, nun aber als Tabu gestrichenen Wörtern aussortiert werden. Und wenn die Lebensläufe berühmter Figuren durchleuchtet und diese nur noch gelten gelassen werden, wenn sie eine moralisch reine Weste bewahrt haben, und sei es auch in noch so komplizierten Zeiten.
Man muss das alles nicht, wie es etwa der ja immer zeitgeistkritische Philosoph Peter Sloterdijk mit den Jakobinern in der Französischen Revolution vergleichen, die im Namen des vermeintlich Guten vor allem auch gnadenlos und massenhaft die Guillotine sprechen ließen – zumal es dabei ja tatsächlich um einen sozialen Umsturzversuch mit Unterstützung der unterdrückten Unterschicht gegen eine alles andere als demokratische Obrigkeit ging. Aber wenn nun, vor allem aus Gebildetenschichten und mit Gesinnungszentren an den Universitäten in lebensferner und wachsender Rigorosität gegen die auch sprachliche Normalität einer Gesellschaft vorgegangen wird, enttarnt sich die anfangs vielleicht gut gemeinte Wokeness einfach nur noch als Fluch.

Schon sehr früh in der Debatte hat die Autorin Thea Dorn über die Wokeness gesagt: Über manches davon könne man ja reden – aber doch nicht jetzt, wir hätten jetzt Wichtigeres zu tun. Vor vielen Jahren hat sie indes ein eindrucksvolles Kurzwerk mit dem Titel „Bombsong“ geschrieben: Die Wutrede eine junge Frau, die sich in einer Gesellschaft wiederfindet, deren Fehler sie an allen Ecken und Enden sieht, die aber bei jedem ihrer Einsprüche nur noch müde seufzt, hatten wir doch schon, versuchen wir doch bereits. Alles, wogegen sie zu treten versucht, ist bereits gepolstert. Und das steigert die Wut nur noch …
In was für einer Gesellschaft finden sich die heutigen jungen Generationen wieder, denen es ja zum Glück nicht egal ist, in welcher Welt sie leben, und die sehr wohl wissen, dass sie das Glück haben, nicht auf irgendeinem Schlachtfeld verheizt zu werden oder den Hungertod fürchten zu müssen? Ist es etwa keine, die an allen Ecken und Enden ihre Fehler offenbart? Sie haben die nicht von ihnen verschuldete, aber vor allem ihre Zukunft betreffende Zuspitzung Klimafrage vor Augen und bleiben eben nicht, wie zuvor so oft beklagt, unpolitisch. Sie erleben Enttarnungen weitverbreiteter Missstände durch „Black Lives Matter“ oder „#MeToo“, die in den USA ihren Ausgang nehmen, aber dann auch in Deutschland zu skandalösen Offenbarungen führen, nicht selten intern bekannt, aber halt hingenommen und verschwiegen. In den sozialen Medien aber organisiert sich ja nicht nur Empörung, sie sorgen zunächst und vor allem erst mal dafür, dass sich Opfer von Diskriminierungen artikulieren und verständigen können. Das Erkennen der fatalen Muster reicht so bis ins eigene Umfeld hinein. Und war es nicht immer Zeichen gelebter Solidarität, dass sich nicht nur die, die betroffen sind, gegen Missstände engagieren? Das ist nur zum Beispiel und nicht zufällig genau die Botschaft von Henry David Thoreau, des Vordenkers des zivilen Ungehorsams. Aber die Gesellschaft, sie erregt sich stets nur kurz und seufzt dann müde, kehrt zur vermeintlichen Normalität zurück. In einen Alltag – man muss kein Genie sein, um das zu erkennen – der auf himmelschreienden globalen Ungerechtigkeiten basiert.
Der Unmut sucht sich seine Symbole
Und ist es zugleich etwa keine Gesellschaft, in der sie aufwachsen, die ihr mit ihren Idolen und bis in die Fürsorge und die Lebensgestaltung ihrer eigenen Eltern hinein zeigt, dass es darum geht, einen eigenen, ihnen entsprechenden Weg zum Glück zu finden? Und da die Jugend ja auch zuverlässig dazu da ist, herrschende Lebensmodelle zu hinterfragen: Wie verlässlich wirkt Glück, das die Mann-Frau-Kinder-Familie verheißt, wenn sie alltäglich deren Scheitern sehen und sich in ihren Rollenbilder nicht wiederfinden (wollen)? Muss das irgendwie alles Normalität sein? Geschenkt, dass qua Natur Frau und Mann nun mal Kinder erzeugen – aber die klassische Romantik ist eben auch eine kulturelle Konstruktion: In der Menschheitsgeschichte wurden Partnerschaften immer schon mal bunter und breiter verstanden. Wir haben Wichtigeres zu tun?
So wie sich das Leben neue Wege sucht, sucht sich der Unmut seine Symbole. Interessanterweise treffen sich die illiberalen Mächten dieser Welt in der Verachtung, im Verbot, in der Bekämpfung von all dem, wofür Wokeness steht: Putin, Erdogan, Trump … Und verlange da nun, bloß weil es in Deutschland weniger Feinde gibt, niemand von einer revoltierenden Jugend Augenmaß und Realismus. So wie es von demokratischen Staaten oft heißt, sie habe letztlich doch die Regierung, die zu ihr passe, kann man es auch für die Jugend sehen, zumal wenn sie auf ältere Menschen treffen, die dieselben Kämpfe schon seit längerem und erfolglos führen: Wenn die Gesellschaft hier in ihrem Abbild eine Fratze zu erkennen meint, muss das nun wirklich keine Verzerrung im Spiegel sein.
Und wer aus der vermeintlichen Mehrheit der Bürger einen Anspruch auf Normalität ableiten zu können meint, dem sei zweierlei vor Augen gehalten: Mit zunehmender Größe der Städte ist längst alltäglich, in jedem Sinn diversen Lebensmodellen zu begegnen, die in kein weißes, binäres Schema mehr passen (und sich gerne auch mit Regenbogen zeigen). Ist das nun aber nicht auch Normalität? Wer das verneint, erklärt damit alles Nicht-Traditionelle zum Un-, zum Abnormalen, das dementsprechend nicht gleich behandelt werden muss, also diskriminiert werden kann – und sei es auch nur dadurch, dass man es nicht ernst nimmt. Normalität ist keine Frage der Statistik, sondern wer sie postuliert, erhebt eine Deutungsmacht.
Somit leistet die Wokeness bei all den Fällen, in der sie aus Überschwang blind für jegliches Maß wird, einen wichtigen Beitrag zur moralischen Selbstaufklärung unserer Zeit – über ihre versteckten Dogmen und blinden Flecken. Und ist damit ein Segen, nicht nur für all ihre Opfer.

Wie soll das aber zusammengehen und nicht viel mehr zu einem sich zuspitzenden Gegeneinander führen?
Zum einen bräuchte es dafür die Bereitschaft zur Erkenntnis derer, die Wokeness für einen Fluch halten, dass eine Gesellschaft Normalität immer ja selbst erzeugt und also immer neu aushandeln muss – und dass neue Generationen auch das Recht haben, ihre eigene Geschichte zu schreiben. Zum anderen bräuchte es bei denen, die Wokeness für einen Segen halten, die Fähigkeit zum Verständnis, dass im selben Maße, wie sie ihre Freiheit einfordern, es auch all den anderen zusteht – und dass alles, was ist, auch eine Geschichte hat, die nicht einfach mit heutigen Maßstäben zu säubern ist. Das jedenfalls würde den Anteil von Fluch und Segen über die gegensätzlichen Seiten dieser Debatte schon mal gerechter verteilen. Aber es würde auch helfen zu unterscheiden, wer jeweils wo diese doppelten Mechanismen der Empörung nur bedient, um selber lauter vernommen und wirkmächtiger zu werden. Eine Instrumentalisierung zur Spaltung der Gesellschaft durch eigentlich ja wirklich notwendige moralische Fragen würde jedenfalls nur denen nutzen, für die Moral die Absolutheit des eigenen Anspruchs bedeutet: Radikalen.
Für die beste Verbindung kann jedenfalls gerade in einer solchen Debatte, die ja tief in die Familien hineinreicht, immer noch die gültige alte Liebe sorgen: von Eltern und zu ihren Kindern, aber auch andersrum. Ein Einander-Zuhören und Verstehen-Wollen, das das Glück des anderen mit im Blick hat – aber nicht nach den eigenen Maßstäben, sondern nach denen des je anderen. Eine vermeintlich verlässliche Normalität, die beides in einer Tradition zum Gleichen macht, gibt es nicht mehr.
